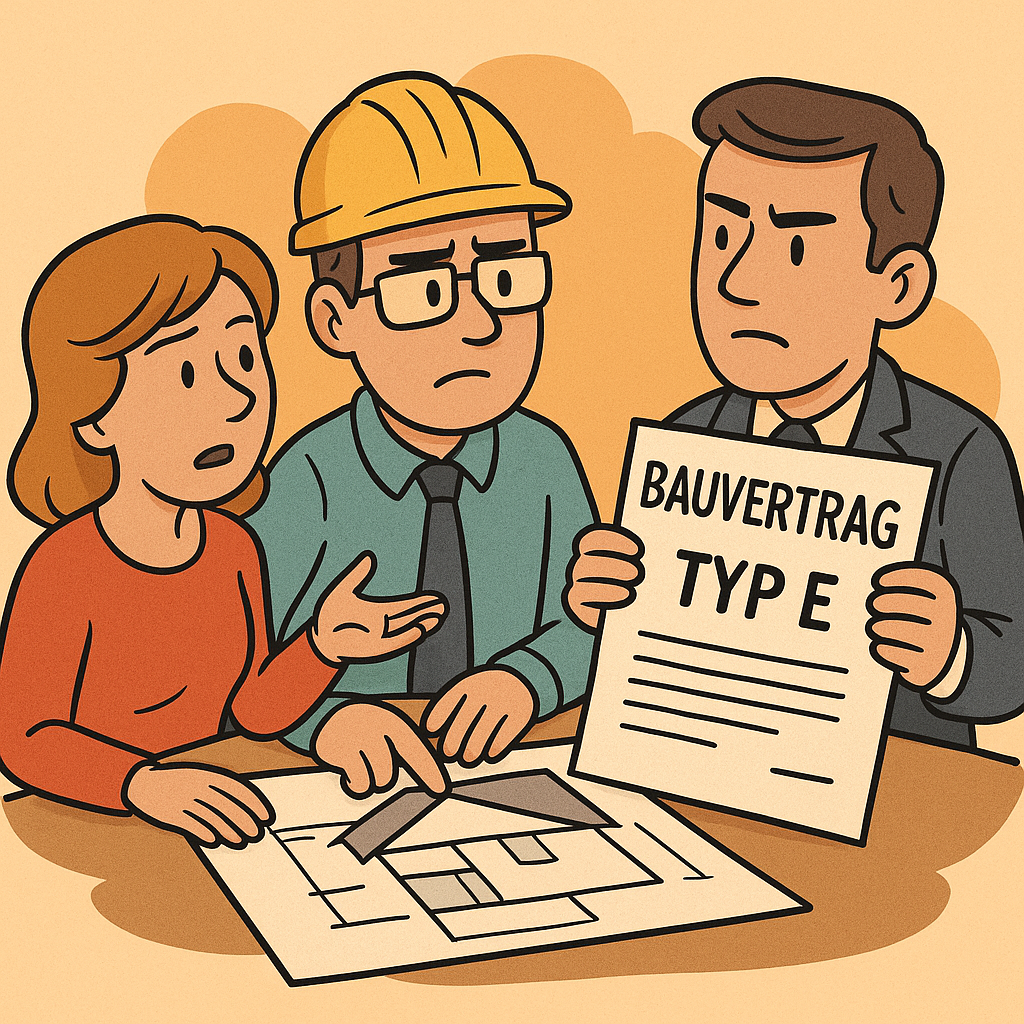Das geplante Gebäudetyp-E-Gesetz könnte die größte baurechtliche Reform seit Jahrzehnten einleiten – und eine Tür öffnen für mehr Innovation, Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit im Bauwesen. Während bisher nahezu jede technische Abweichung von anerkannten Regeln der Technik ein Risiko für Architekten, Planer und Bauträger bedeutete, soll künftig das Gegenteil gelten: Abweichungen sind ausdrücklich erlaubt, sofern sie bewusst vereinbart und dokumentiert werden.
Innovationen endlich rechtssicher umsetzbar
Das Baurecht galt bislang als innovationshemmend. Viele neue Baustoffe oder Bauweisen – etwa Recyclingbeton, Lehmbau, Holzmodulbau oder 3D-Druckverfahren – ließen sich nur schwer in die Praxis übertragen, weil sie nicht den „anerkannten Regeln der Technik“ im Sinne des § 13 Abs. 1 VOB/B oder der einschlägigen DIN-Normen entsprachen. Wer sie dennoch einsetzte, riskierte Mängelrügen, Gewährleistungsstreitigkeiten oder Regressforderungen.
Mit dem Gebäudetyp E ändert sich das grundlegend: Bauherren und Unternehmer können künftig gemeinsam festlegen, dass ein Bauvorhaben auch dann rechtmäßig ist, wenn es von bestehenden technischen Normen abweicht. Diese Abweichung stellt keinen Mangel dar, solange die vereinbarte Funktionalität, Sicherheit und Gebrauchstauglichkeit gewährleistet bleibt.
Die neue Rolle der Bundesregierung: Normen müssen nicht mehr verbindlich sein
Ein Kernpunkt des Gesetzes ist die Ermächtigung der Bundesregierung, per Rechtsverordnung festzulegen, welche technischen Normen künftig nicht zwingend Vertragsbestandteil eines Bauvertrags sein müssen. Das bedeutet: DIN-Normen und technische Richtlinien gelten nicht mehr automatisch, sondern nur dann, wenn die Parteien sie ausdrücklich in den Vertrag aufnehmen.
Für die Baupraxis bedeutet das mehr Freiheit – aber auch mehr Verantwortung. Planer und Bauherren müssen künftig gemeinsam entscheiden, welche Standards sie anwenden wollen und welche nicht. Das eröffnet Spielräume, etwa bei der Verwendung nachhaltiger Baustoffe, beim modularen Bauen oder bei ressourcenschonenden Sanierungsmethoden.
Beispiel: Innovation trifft Wirtschaftlichkeit
Ein Architekt will ein Mehrfamilienhaus aus recyceltem Beton planen. Nach bisherigem Recht war das riskant, weil das Material keine umfassende DIN-Zertifizierung besaß. Mit dem Gebäudetyp-E-Gesetz kann diese Bauweise ausdrücklich vereinbart werden, wenn sie die notwendige Sicherheit und Gebrauchstauglichkeit bietet – auch ohne vollständige Normkonformität.
Damit eröffnet das Gesetz neue Perspektiven für nachhaltiges und kosteneffizientes Bauen – etwa durch die Wiederverwendung von Baustoffen, regionale Materialien oder vereinfachte Bauweisen. Gerade in Zeiten knapper Ressourcen und hoher Baupreise ist das ein wichtiger Schritt in Richtung Zukunftsfähigkeit.
Praxisrelevanz für Architekten, Planer und Bauträger
Für die Praxis bedeutet der Gebäudetyp E: Mut zur Innovation wird endlich rechtlich abgesichert. Architekten und Planer können neue Bauweisen entwickeln, ohne rechtliche Nachteile befürchten zu müssen. Bauträger profitieren von flexibleren Vertragsmodellen und geringeren Baukosten. Und Bauherren gewinnen, weil sie Projekte realisieren können, die bisher an überzogenen Normanforderungen gescheitert wären.
Fazit
Das Gebäudetyp-E-Gesetz ist ein Meilenstein für modernes, nachhaltiges und innovationsfreundliches Bauen. Es beendet die faktische „Normenpflicht“ im Baurecht und eröffnet Raum für neue Materialien, kreative Lösungen und ökonomisch tragfähige Bauprojekte – ohne rechtliches Risiko.
ADVOCA Rechtsanwälte berät Bauherren, Architekten und Bauträger zur rechtssicheren Umsetzung innovativer Baukonzepte nach dem Gebäudetyp-E-Gesetz.
Kontaktieren Sie uns unter info@advoca.de, um Ihr Bauprojekt zukunftssicher zu gestalten.
Mehr zu diesem Thema
07. Nov.. 2025
Mit dem neuen Gebäudetyp-E-Gesetz bricht für Architekten, Bauunternehmer und Bauherren eine neue Ära an. Zum ersten Mal erlaubt der Gesetzgeber, dass Bauprojekte bewusst von technischen Standards – insbesondere von DIN-Normen – abweichen dürfen, [...]
04. Nov.. 2025
Mit dem geplanten Gebäudetyp-E-Gesetz will das Bundesministerium der Justiz das Bauen in Deutschland einfacher, günstiger und flexibler machen. Ziel ist es, die gesetzlichen Rahmenbedingungen so zu verändern, dass Bauherren, Architekten und Unternehmer künftig [...]
15. Okt.. 2024
Kaufen Sie eine Wohnung von einem Bauträger, so steht Ihnen eine Gewährleistung des Bauträgers wegen Mängeln zu, die nach Ablauf von (in der Regel) fünf Jahren nach wirksamer Abnahme verjährt. Treten Mängel innerhalb [...]