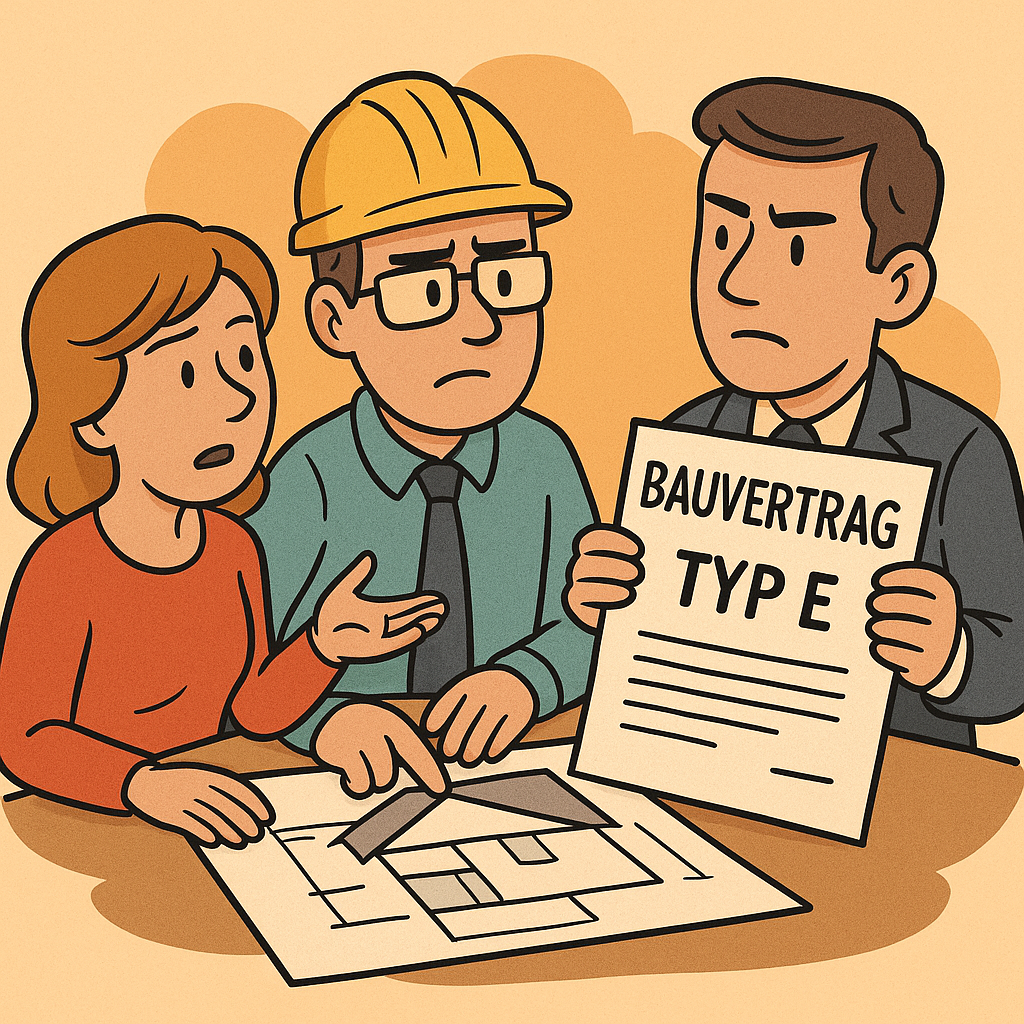Mit dem neuen Gebäudetyp-E-Gesetz bricht für Architekten, Bauunternehmer und Bauherren eine neue Ära an. Zum ersten Mal erlaubt der Gesetzgeber, dass Bauprojekte bewusst von technischen Standards – insbesondere von DIN-Normen – abweichen dürfen, ohne dass dies automatisch als Mangel gilt. Was nach Freiheit klingt, bringt für die Baupraxis aber auch neue juristische Unsicherheiten.
Auswirkungen auf bestehende Bauverträge
Für laufende Bauverträge gilt weiterhin das bisherige Recht: Solange kein ausdrücklicher Verweis auf den Gebäudetyp E vereinbart wurde, bleiben die anerkannten Regeln der Technik und die üblichen Normen verbindlich. Das neue Gesetz greift also nicht rückwirkend – es wirkt erst für Verträge, die nach Inkrafttreten geschlossen werden.
Allerdings sollten Bauherren und Unternehmer bereits jetzt prüfen, wie bestehende Verträge angepasst werden können, wenn ein Bauvorhaben unter vereinfachten Bedingungen abgeschlossen oder fortgeführt werden soll. In solchen Fällen muss eine klare vertragliche Ergänzung erfolgen, die regelt, welche Standards gelten und von welchen bewusst abgewichen wird. Fehlt diese Vereinbarung, bleibt es beim alten Haftungsrisiko.
Neue Anforderungen an Vertragsgestaltung
In Zukunft wird die präzise Formulierung technischer Standards zu einem der wichtigsten Punkte jedes Bauvertrags. Denn der bisher übliche Verweis auf „anerkannte Regeln der Technik“ reicht künftig nicht mehr automatisch. Bauherren und Unternehmer müssen explizit festlegen, welche Normen gelten sollen – und welche nicht. Das gilt besonders dann, wenn einfachere oder kostengünstigere Bauweisen gewählt werden.
Fehlt eine klare Regelung, entsteht schnell Streit: Wird ein Bauvorhaben nach Typ E ausgeführt, der Bauherr aber nicht ausreichend informiert, kann das im schlimmsten Fall zu Haftungs- und Nachbesserungsansprüchen führen.
Öffentliche Bauvorhaben: Mehr Flexibilität, aber hohe Hürden
Für öffentliche Auftraggeber bringt das neue Gesetz ebenfalls Spielräume – allerdings nur begrenzt. Im Bereich öffentlicher Ausschreibungen gilt weiterhin das Vergaberecht, das auf Transparenz und Gleichbehandlung basiert. Die bewusste Abweichung von technischen Normen muss dort ausdrücklich begründet und dokumentiert werden. Insbesondere im sozialen Wohnungsbau könnte der Gebäudetyp E jedoch zu einer echten Kostenentlastung führen, wenn etwa auf überzogene Komfortanforderungen verzichtet wird.
Neue Konfliktlinien in der Baupraxis
Das Gebäudetyp-E-Gesetz wird neue Konfliktfelder eröffnen – vor allem bei der Frage, was genau vereinbart wurde. Gerichte werden künftig häufiger prüfen müssen, ob Bauherren die Abweichung von Standards tatsächlich verstanden und akzeptiert haben. Auch die Rolle der Planer und Architekten wird sich verändern: Sie müssen künftig dokumentieren, dass alle technischen Abweichungen fachlich vertretbar und dem Bauherrn bekannt waren.
Fazit: Vertragsklarheit ist entscheidend
Das Gebäudetyp-E-Gesetz bringt mehr Freiheit, mehr Verantwortung und neue juristische Fallstricke. Wer künftig auf vereinfachtes oder experimentelles Bauen setzt, muss auf eine saubere Vertragsgestaltung achten. Nur so lassen sich Haftungsrisiken vermeiden und Innovationen rechtssicher umsetzen. Die Kanzlei ADVOCA Rechtsanwälte berät Bauträger, Architekten und private Bauherren bei der rechtssicheren Ausgestaltung von Typ-E-Projekten.
Unser Fazit: Das Gesetz ist ein Meilenstein für modernes Bauen – aber nur klare Verträge schaffen Rechtssicherheit. Kontaktieren Sie uns unter info@advoca.de, um Ihr Bauvorhaben rechtssicher zu gestalten.
Mehr zu diesem Thema
11. Mai. 2023
Ein verdeckter Mangel im Bauvertrag ist ein Mangel, der zum Zeitpunkt der Abnahme des Bauwerks nicht sichtbar war oder nicht offensichtlich erkennbar war. Das bedeutet, dass der Mangel bei der Abnahme nicht bemerkt [...]
30. Juli. 2023
Die Bedenkenanzeige ist ein wichtiges Instrument im Bauvertrag, um potenzielle Probleme und Risiken frühzeitig anzusprechen und gemeinsame Lösungen zu finden. Aber wann genau ist eine Bedenkenanzeige erforderlich? In diesem Blogbeitrag werden wir genauer [...]
11. Mai. 2023
Ein Bauvertrag regelt alle rechtlichen und finanziellen Aspekte eines Bauprojekts. Die Abnahme ist ein wichtiger Bestandteil des Vertrags und markiert den Zeitpunkt, an dem das Bauvorhaben als fertiggestellt gilt. In diesem Blogbeitrag werden [...]